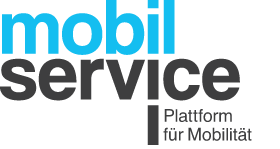E-Trottinette: Studien zur Verkehrsintegration und Prävention von Unfällen
zugeordnete Tags/Schlagwörter
Erstellt am 01.07.2025
 Attraktive und sichere Veloinfrastrukturen kommen auch E-Trottinetts zugute (Foto: vecteezy.com)
Attraktive und sichere Veloinfrastrukturen kommen auch E-Trottinetts zugute (Foto: vecteezy.com)
E-Trottinette verbreiten sich in Schweizer Städten. Welche Anforderungen stellen diese an den zukünftigen Verkehrsraum und wie gelingt die nachhaltige Integration ins Gesamtmobilitätssystem? Diesen Fragen ging die Büro für Mobilität AG im Rahmen einer Studie nach, die im Auftrag der SVI, gemeinsam mit der Ostschweizer Fachhochschule, der Analysis Simulation Engineering AG (ASE) und der Arbeitsgruppe für Unfallmechanik (AGU) durchgeführt wurde.
Die wichtigsten Erkenntnisse: Es braucht keine zusätzliche Infrastruktur, aber gezielte Anpassungen. Direkte, attraktive und sichere Veloinfrastrukturen nützen auch dem E-Trottinett und diese sollten bei der Verkehrsplanung und Planung von Mobilitätsangeboten systematisch mitgedacht werden, z. B. durch Tarifintegration von Sharing-Angeboten. Das methodische Vorgehen der Studie basiert auf einer Literaturauswertung, Fachgesprächen mit Expert:innen, einer Befragung von Nutzenden und Nicht-Nutzenden, Modellierungen sowie Fahrversuchen mit 360°-Videoaufnahmen.
E-Trottinette bieten flexible Mobilität, bringen aber auch Herausforderungen mit sich, wie das "wilde" Abstellen auf Gehwegen, die Nachhaltigkeit der E-Trottinette oder Unfälle. Gemäss neuster Unfallstatistik sind 86 % der schweren E-Trottinett-Unfälle selbst verursacht. Es handelt sich insbesondere um junge Erwachsene, die oft alkoholisiert und nachts unterwegs sind. Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), der Technischen Universität Dresden und der Technical University of Denmark, finanziell unterstützt durch die AXA Stiftung für Prävention, untersuchte deshalb, was junge Menschen in solchen Situationen zur Nutzung bewegt. Dabei kam heraus, dass die Entscheidung oft spontan und situativ ist. Die zwei wichtigsten Einflussfaktoren sind das Verhalten Gleichaltriger und in welcher Form alternative Transportmittel zur Verfügung stehen. Das soziale Umfeld hat somit einen starken Einfluss, sowohl schützend als auch risikofördernd. Steigt die Gruppe aufs Trottinett, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Einzelne mitziehen, obwohl das Risikobewusstsein vorhanden ist.
Projektleiter Markus Hackenfort von der ZHAW fordert deshalb neue Ansätze in der Prävention: "Statt nur auf bereits schwer zu überwachende Regeln und Verbote zu setzen, sollten wir Bedingungen fördern, die sichere Entscheidungen einfacher machen – im Moment der Entscheidung selbst."
Mehr zum Thema Mikromobilität gibt es im Energiepodcast von EnergieSchweiz: Expert:innen des BFE und der Uni Lausanne diskutieren dort Chancen, Herausforderungen und inspirierende Initiativen.
Weitere Informationen
- Büro für Mobilität AG: SVI-Studie "E-Trottinette: Verkehrsplanerische Auswirkungen und zukünftige Anforderungen" (März 2025)
- AXA Stiftung Prävention: Prävention von E-Trottinett-Unfällen junger Fahrer:innen
- Psychologisches Institut der ZHAW: Spontan statt geplant: Warum junge Erwachsene nachts zum E-Trottinett greifen
- Energiepodcast EnergieSchweiz: Entdecken Sie die Mikromobilität für Ihre Stadt oder Gemeinde
- Mobilservice News Dossier "Mikromobilität: Die Nutzung kennen, um sie besser zu steuern" (März 2025)
- Mobilservice News Dossier zu Mikromobilität und E-Leichtfahrzeugen (Oktober 2023)
- Mobilservice News Dossier "Elektrische Kleinstfahrzeuge und ihre Ansprüche an Verkehrsinfrastrukturen" (April 2023)
Dokumente auf Deutsch
- Studie "E-Trottinette: Verkehrsplanerische Auswirkungen und zukünftige Anforderungen" (SVI & ASTRA, März 2025) [PDF, 4.43 MB]
- Medienmitteilung ZHAW vom 29.05.2025 "Spontan statt geplant: Warum junge Erwachsene nachts zum E-Trottinett greifen" [PDF, 144.9 KB]
Dokumente auf Französisch
- Étude "Conséquences pour la planification des transports et futures exigences des trottinettes électriques" (résumé en français) [PDF, 4.43 MB]