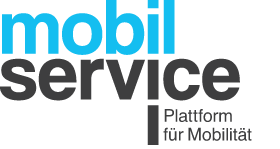Citylogistik: Städte im Umgang mit Online-Shopping und Güterverkehr
zugeordnete Tags/Schlagwörter
Erstellt am 06.11.2025
 Vermehrte Fahrten von Lieferwagen führen zu Nutzungskonflikten im öffentlichen städtischen Raum (Foto: QIMBY)
Vermehrte Fahrten von Lieferwagen führen zu Nutzungskonflikten im öffentlichen städtischen Raum (Foto: QIMBY)
Online-Shopping ist bequem, günstig und längst Alltag geworden. Die Folgen: Mehr Lieferfahrten durch fragmentierte Lieferketten und Rücksendungen sowie das Halten in zweiter Reihe führen zu Staus, höheren CO₂-Emissionen und Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Wie gehen Städte mit diesen Herausforderungen um?
Eine Studie der Métropole Grand Lyon und des Bureau Mobil'Homme erforschte, wie Kaufverhalten und Citylogistik zusammenhängen. Daraus resultierten drei zentrale Handlungsmöglichkeiten: Konsument:innen stärker für die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens zu sensibilisieren, lokale Händler beim Umstieg auf nachhaltige Vertriebskanäle zu unterstützen und die «letzte Meile» durch Abholstationen oder neue Logistikformen zu entlasten.
Auch der 20. Berner Verkehrstag vom 22. August 2025 rückte die städtische Güterlogistik in den Fokus. Die Stadt Bern geht die Herausforderungen kleinerer, häufigerer Paketsendungen und begrenzten Logistikflächen mit regelmässigen «Güterverkehrsrunden» an. Dabei bringt die Stadt Handel, Logistik, Verwaltung, Politik und Anwohner:innen an einen Tisch, um Handlungsfelder zu identifizieren und Projekte aufzubauen. Netzwerk und Zusammenarbeit, Verständnis für verschiedene Bedürfnisse sowie Mut und Neugier für neue Lösungen sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren. Neue Technologien wie Elektrifizierung, Digitalisierung und autonome Fahrzeuge bieten ausserdem Chancen für eine nachhaltige Zukunft.
Ein Blick nach Hamburg zeigt, dass technologische Lösungen allein jedoch nicht genügen. Im Pilotprojekt «Smarte Liefer- und Ladezonen (SmaLa)» mit 20 digital buchbaren Stellplätzen konnten Verkehrsfluss und Emissionen nur gering verbessert werden und die Wirkung hing stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Die durchschnittliche Buchungsdauer betrug 46 Minuten, wobei vor allem spontane Buchungen erfolgten. Zudem gab es viele Fehlbelegungen, insbesondere durch Handwerker:innen. Trotzdem bewerteten Nutzer:innen das System positiv. Fazit: Die Schaffung von Stellplätzen für den Lieferverkehr stellt einen wesentlichen Baustein nachhaltiger urbaner Logistikkonzepte dar. Entscheidend ist nicht zwingend die «smarte» Technik, sondern eine ausreichende Anzahl von Ladezonen, gut gewählte Standorte und verfügbare Belegungsinformationen.
Auch Cargo sous terrain (CST) richtet den Fokus nun auf Citylogistiklösungen: Das ursprünglich geplante unterirdische Logistiksystem gilt zwar als technisch machbar, es fehlt aber derzeit an politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Trotz Neuorientierung bleibt das Ziel, langfristig eine umweltfreundliche Güterverteilung in der Schweiz zu ermöglichen.
Weitere Informationen
- Berner Verkehrstag 2025: Rückblick im Infoletter Güterverkehr und Logistik
- Kanton Zürich: Dritte Zürcher Güterverkehrsrunde 2025
- Stadt Bern: Güterverkehrsrunde Stadt Bern 2025
- Mobilservice News Dossier "Pilotprojekt mit automatisiertem Lieferfahrzeug in der Stadt Bern" (Dezember 2024)
- Mobilservice News Dossier "Wirtschaftsverkehr und Logistik im urbanen Raum: Erkenntnisse und Handlungsoptionen aus der Forschung" (Oktober 2024)
- Mobilservice News Dossier "Cargo sous terrain: Ein privatwirtschaftliches Projekt soll den Strassengüterverkehr reduzieren" (April 2021)
Dokumente auf Deutsch
- Bericht "Smarte Lade- und Lieferzonen - Evaluation des Projekts Smarte Lade- und Lieferzonen (SmaLa) in Hamburg" (Behörde für Wirtschaft und Innovation, Hamburg, 2025) [PDF, 13.8 MB]
- Medienmitteilung Cargo sous terrain AG vom 08.09.2025: Cargo sous terrain stellt sich zukunftsgerichtet auf [PDF, 2.52 MB]